
Allergisches Asthma: Symptome und Therapie
Allergisches Asthma zählt zu den häufigsten Formen der Erkrankung. An sich harmlose Stoffe lösen eine Überreaktion des Immunsystems aus. Mögliche Allergene sind Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare.
Lesedauer ca. 4 Minuten
Bei Menschen mit Asthma bronchiale können bereits alltägliche Reize dafür sorgen, dass das Atmen zum Kraftakt wird. Die Auslöser sind unterschiedlich. Bei einigen Patient*innen lösen Erkältungen starken Hustenreiz und Atemnot aus. Bei anderen Betroffenen führt der Kontakt mit Blütenpollen, ein Sprint zum Bus oder auch nur kalte Winterluft dazu, dass sich ihre Atemwege verengen. Allen ist eines gemeinsam: Ihre Lebensqualität kann darunter stark leiden.
In Deutschland sind rund fünf Prozent der Erwachsenen und zehn Prozent der Kinder von Asthma betroffen.1 Bei einigen Kindern und Jugendlichen besteht die Chance, dass die Erkrankung mit der Zeit wieder verschwindet. In der Regel jedoch handelt es sich bei Asthma um eine chronische Krankheit. Dies bedeutet, dass sie ein Leben lang fortbesteht – denn bislang ist Asthma nicht heilbar.
Es gibt auch eine gute Nachricht: Mit der passenden Therapie lassen sich Asthma und seine Symptome in den meisten Fällen gut kontrollieren. Eine moderne Behandlung besteht aus mehreren Komponenten. Neben dem Meiden individueller Auslöser spielt unter anderem auch die Einnahme von Medikamenten eine wichtige Rolle. Für viele Patient*innen ist auf diese Weise ein weitgehend beschwerdefreier Alltag möglich.

Allergisches Asthma zählt zu den häufigsten Formen der Erkrankung. An sich harmlose Stoffe lösen eine Überreaktion des Immunsystems aus. Mögliche Allergene sind Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare.
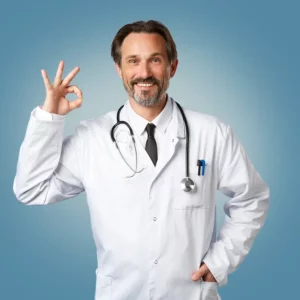
Bei der Lungenfunktionsprüfung kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Die Messwerte ermöglichen die Asthma-Diagnose und geben Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Lunge.

Von nicht-allergischem (intrinsischem) Asthma sind meist erwachsene Patient*innen betroffen. Reize wie feuchte Luft, Stress oder Infekte der Atemwege können bei ihnen einen Anfall auslösen.

Allergisches Asthma zählt zu den häufigsten Formen der Erkrankung. An sich harmlose Stoffe lösen eine Überreaktion des Immunsystems aus. Mögliche Allergene sind Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare.
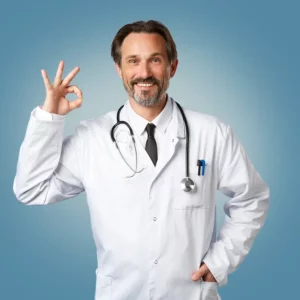
Bei der Lungenfunktionsprüfung kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Die Messwerte ermöglichen die Asthma-Diagnose und geben Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Lunge.

Die meisten Medikamente die zur Behandlung von Asthma genutzt werden werden mithilfe eines Inhalators eingeatmet Dafür stehen unterschiedliche Geräte zur Verfügung

Bei der Behandlung von Asthma kommen unterschiedliche Medikamente zum Einsatz um Beschwerden zu lindern und ihnen vorzubeugen Man unterscheidet zwischen Dauertherapie und Bedarfstherapie

Für die Therapie von Asthma stehen unter shy schiedliche Medikamente zur Verfügung Welche Wirkstoffe im individuellen Fall eingesetzt werden kann anhand eines Stufen shy schemas bestimmt werden

Asthma ist gekennzeichnet durch eine Reihe von charakteristischen Symptomen wie Husten und Atemnot Diese treten in der Regel anfallartig auf

Asthma lässt sich in unterschiedliche Formen und Typen einteilen Für die Therapie ist der Grad der Asthmakontrolle sehr wichtig
Mit den Texten und Servicematerialien von asthma-alltag.de möchten wir Sie auf Ihrem Weg in einen unbeschwerteren Alltag unterstützen. Die Angebote richten sich in erster Linie an Patient*innen mit Asthma, aber auch an Angehörige und Interessierte.
Asthma bronchiale ist eine komplexe Erkrankung, die bei jeder Patientin und jedem Patienten einen individuellen Verlauf nimmt. Um welche Form es sich bei Ihnen handelt, wie es um die Gesundheit Ihrer Lunge bestellt ist und welche Maßnahmen im Rahmen der Therapie zum Einsatz kommen sollten – all diese Punkte können Sie gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt besprechen.
Doch nicht immer hat das ärztliche Fachpersonal im Praxisalltag genug Zeit, Betroffenen alle Details ihrer Erkrankung ausführlich und laiengerecht zu erläutern. Wir möchten Ihnen weiterhelfen: Auf unserem Portal asthma-alltag.de finden Patient*innen, Angehörige und Interessierte umfangreiches und gut verständliches Hintergrundwissen zu dieser Lungenerkrankung.
Die Informationen auf asthma-alltag.de orientieren sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen von Expert*innen. Unser Angebot beschränkt sich jedoch nicht allein auf Hintergrundwissen: Bei aller Theorie darf die Praxis nicht zu kurz kommen. Auf diesen Seiten finden Sie daher lebensnahe Tipps und nützliche Services. Wir möchten, dass Sie Ihren ganz persönlichen Weg finden, um mit Ihrer Erkrankung bestmöglich umzugehen – damit Sie im Alltag so wenig wie möglich von ihr eingeschränkt werden.
1 Pschyrembel Online: Asthma bronchiale, Stand Juli 2023, https://www.pschyrembel.de/Asthma%20bronchiale/K032W, Zugriff am 15.02.2024.